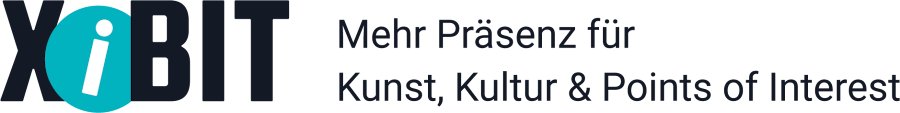Johann Wilhelm Klein, der im Jahre 1804 das k. k. Blindenerziehungsinstitut in Wien begründete, legte bereits in den Dreißigerjahren das Museum an, welches in verschiedenen Abteilungen einen Überblick über die Entwicklung der Lehr- und Lernbehelfe für den Blindenunterricht – es reicht von Musik, Mathematik, Geographie bis Biologie. Unter anderem sind folgende historische Unterrichtsbehelfe zu besichtigen: Notenapparate, Tastuhren, Zeichenapparate für den Geometrieunterricht, Landkarten, Globen, Tiermodelle, …
Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung der verschiedenen Schriften für Blinde bis zur eigentlichen „Blindenschrift“, die von Louis Braille 1825 entwickelt wurde. Bevor sich die Schrift Brailles durchsetzen konnte, wurde mit unterschiedlichsten Methoden und Schriftarten versucht eine schriftliche Kommunikation zwischen Blinden und Sehenden zu ermöglichen. Die verschiedenen Formen von Hochschriften reichten von Buchstaben über unterschiedliche Reliefschriften bis zu einzelnen ausgeschnittenen Buchstaben, die aufgeklebt und ertastet werden konnten. Der Wiener Mechaniker Carl Ludwig Müller entwickelte eine tastbare „Masseschrift“ 1806. Dies führte zur „erstmaligen“ Erfindung der Füllfeder.
Neben der Entwicklung der Schrift für Blinde präsentiert das Museum auch die Entwicklung von Schreibmaschinen für Blinde und des Buchdruckes von Blindenbüchern in „Hochdruck“.
Die bedeutende grafische Sammlung des Museums umfasst rund 1700 Blätter zum Thema Blindheit. Die ersten Bilder waren Schenkungen, die Johann Wilhelm Klein für sein Institut erhielt. In vielen Bildern wird die soziale Stellung des Blinden veranschaulicht. Darstellungen reichen vom Blinden im Altertum, im Orient bis zu Blindenberufen des 19. und 20. Jahrhunderts.
Blinde wurden im 19. Jahrhundert vor allem in handwerklichen Berufen ausgebildet. Dem Handwerk, das auch heute noch seine Berechtigung hat, ist ein eigener Raum gewidmet.
Das Museum des Blindenwesens ist eines der reichhaltigsten dieser Art und genießt internationalen Ruf.
Ähnliches