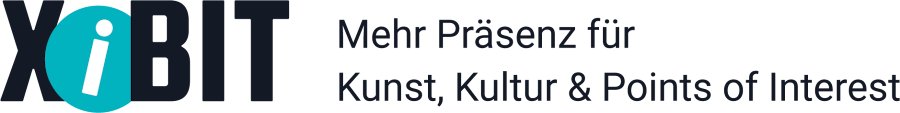Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie – Medizinische Universität Wien
Sehen verstehen. Sehen erhalten. Sehen ermöglichen.
Die Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie der Medizinischen Universität Wien ist das größte und traditionsreichste Zentrum für Augenerkrankungen in Österreich – und zählt auch international zu den führenden Einrichtungen auf diesem Gebiet. Hier verbinden sich medizinische Spitzenversorgung, Forschung auf höchstem Niveau und exzellente Ausbildung unter einem Dach.
Medizinische Exzellenz
Das Behandlungsspektrum der Klinik umfasst alle Bereiche der modernen Augenheilkunde – von Routineuntersuchungen bis zu hochkomplexen mikrochirurgischen Eingriffen. Zu den Schwerpunkten zählen:
- Kataraktchirurgie (Grauer Star) und refraktive Linsenchirurgie
- Glaukomdiagnostik und -therapie (Grüner Star)
- Netzhaut- und Makulatherapie, inklusive Laser- und Injektionsbehandlungen
- Hornhauterkrankungen und Transplantationschirurgie
- Kinderophthalmologie und Frühgeborenenretinopathie
- Okuloplastische und rekonstruktive Chirurgie
- Optometrie und Sehschule
Mit modernster Technologie – von hochauflösender Bildgebung über robotergestützte Mikrochirurgie bis hin zu Laser- und Injektionssystemen – bietet die Klinik eine Versorgung auf internationalem Spitzenniveau.
Forschung und Innovation
Als Teil der Medizinischen Universität Wien ist die Klinik ein aktives Zentrum für Forschung und Innovation. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten hier an neuen Therapieformen für Netzhauterkrankungen, Glaukome, Hornhautdefekte und altersbedingte Makuladegeneration.
Zudem werden neue Operationsverfahren, Implantate und bildgebende Verfahren entwickelt, die weltweit Beachtung finden. Die enge Verzahnung von Klinik und Forschung sorgt dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnisse rasch in die Praxis überführt werden.
Ausbildung und Wissenstransfer
Die Universitätsklinik ist ein zentraler Ausbildungsort für Studierende der Medizin und Optometrie. Neben der klinischen Ausbildung liegt ein besonderer Fokus auf wissenschaftlichem Denken, praktischer Erfahrung und interdisziplinärer Zusammenarbeit – damit die nächste Generation von Augenärzt:innen sowie Optometristinnen und Optometristen bestens auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet ist.
Der Mensch im Mittelpunkt
Bei allem technischen Fortschritt bleibt das Ziel der Klinik unverändert: das Augenlicht und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu erhalten. Einfühlsame Betreuung, individuelle Therapieplanung und der respektvolle Umgang mit jedem Menschen prägen die Arbeit der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie an der Medizinischen Universität Wien – seit Generationen.
Weitere Informationen dazu unter: https://augenheilkunde-optometrie.meduniwien.ac.at
Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien
Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu / Ansprechperson: Sophie Frank-Publig
Gründung und frühe Jahre (1812–1850er)
Die Wiener Universitäts-Augenklinik entstand 1812 - sie gilt als die älteste universitäre Augenklinik der Welt und wurde von Georg Joseph Beer gegründet.
Ausbau der „Wiener Schule“ (Mitte 19. Jh.)
Wien als international führendes Zentrum Lehre und Forschung der Augenheilkunde: Wichtige Persönlichkeiten prägten Operations- und Diagnosetechniken.
Durchbrüche und Technik (spätes 19. Jh.)
Wichtige medizinische Fortschritte gehen aus dem Wiener Umfeld hervor: Karl (Carl) Koller demonstrierte 1884 die Verwendung von Kokain als lokales Anästhetikum für Augenoperationen. Später entstanden in Wien mehrere „Augenkliniken“ (erste und zweite Universitäts-Augenklinik) mit eigenen Lehrstühlen.
„Wiener Schule“: Ernst Fuchs und die Blüte um 1900
Ernst Fuchs‘ (Leiter der II. Univ.-Augenklinik) Arbeiten (Lehrbuch, pathologische Beschreibungen) hatten weltweiten Einfluss und prägten die „Wiener Schule“.
Erste erfolgreiche Hornhaut-Transplantation (1905)
Ein Wiener Schülerkreis/Umfeld brachte auch technische Pioniertaten hervor: Eduard Konrad Zirm führte 1905 die erste erfolgreiche menschliche Hornhauttransplantation durch — ein Meilenstein der Transplantations- und Augenheilkunde.
Zwischenkriegszeit, NS-Zeit und Nachkriegszeit
Karrieren, Personalstruktur und Forschung litten unter der Politik (Emigration, Diskontinuitäten). Nach 1945 erfolgte der Wiederaufbau von Klinikbetrieb, Ausbildung und Forschung. Die Wiener Augenheilkunde knüpfte international wieder an frühere Reputation an.
Modernisierung und Standortentwicklung (spätes 20. Jh. – heute)
Es folgten mehrere Modernisierungen, technische Aufrüstungen und letztlich organisatorische Anpassungen. Die Klinik ist heute eine der größten und technologisch modern ausgestatteten Augenkliniken Europas.
Forschung, Lehre und int. Vernetzung
Die Wiener Augenklinik bleibt ein aktives Zentrum für klinische Forschung, Lehre und internationale Kooperationen; zahlreiche Techniken und Lehrbücher aus Wien haben in der Fachwelt Spuren hinterlassen.
Bedeutung der Augenklinik
In den letzten ~200 Jahren hat die Wiener Augenklinik maßgeblich zur Etablierung der Augenheilkunde als wissenschaftliche Disziplin beigetragen und zählt von der Gründung bis heute als internationales Referenzzentrum.
Der zeitliche Verlauf im Überblick:
1812 – Augenklinik wird von Georg Joseph Beer gegründet
1830–1850 – „Wiener Schule“
1884 – Karl Koller entdeckt Kokain als lokale Betäubung
1905 – Erste erfolgreiche Hornhauttransplantation
1991 – Erstes kommerziell eingesetzte Optische Kohärenztomographie
2004 – Integration in die Medizinische Universität Wien
Wussten Sie schon?
Kokain wird als lokale Betäubung bei Augenoperationen eingesetzt - eine revolutionäre Entdeckung aus Wien!
Bildmaterial
Abbildung 1: Porträt von Georg Joseph Beer und seine Zeichnungen
Abbildung 2: Ernst Fuchs und Kollegen der II. Universitätsklinik
Abbildung 3: Isidor Schnabel mit Kollegen bei der Visite
Quellen: Gröger und Schmidt-Wyklicky, Die Gründung der weltweit ersten Universitäts-Augenklinik in Wien 1812 und ihre Erhebung zum Ordinariat 1818, Spektrum der Augenheilkunde 06/2012
Geschichte der Ophthalmologie in Wien - wog-wien.at/eyekeyvienna Zugriff am 02.10.2025
Sophie Frank-Publig, Ruth Donner, Jan Lammer, Daniel Schartmüller, Gerhart Schmiedinger; Ambulanz für Hornhauterkrankungen und spezielle Implantatchirurgie; Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien / Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Die Hornhaut ist die klare, durchsichtige Schicht an der Vorderseite des Auges. Sie wirkt wie ein „Fenster“, durch das das Licht ins Auge fällt, und spielt eine entscheidende Rolle für scharfes Sehen.
Geschichte
• Bis 19. Jahrhundert: Frühe Zeit
In der Antike und im Mittelalter konnten Ärzte Hornhauterkrankungen nur äußerlich beschreiben.
Man behandelte Entzündungen mit Kräutern oder Salben, oft ohne zu wissen, wie das Auge genau funktioniert.
Erst mit der Entwicklung besserer Mikroskope im 18. und 19. Jahrhundert wurde klar, wie die Hornhaut aufgebaut ist.
• 19.–20. Jahrhundert: Beginn der Moderne
Man erkannte, dass Verletzungen oder Narben auf der Hornhaut das Sehen stark beeinträchtigen.
Erste Operationen versuchten, trübe Hornhautstellen zu entfernen oder zu ersetzen, was 1905 erstmals gelang (Dr. Zirm).
• 20. Jahrhundert
Ab den 1950er-Jahren begannen Ärzte, Hornhautbanken für Spenderhornhäute einzurichten.
Siehe Abbildung 1: Dr. Zirm im Operationssaal
Hornhaut-Transplantationen Heute
Dank moderner Lasertechnik, Mikrochirurgie und künstlicher Hornhäute können viele Hornhauterkrankungen behandelt werden. Auch Zelltherapien und biotechnologische Verfahren können beschädigte Hornhäute regenerieren, ohne sie ersetzen zu müssen.
• klassische Hornhauttransplantation (Perforierende Keratoplastik):
Hier wird die gesamte Hornhaut durch Spendergewebe ersetzt. Sie ist und bleibt ein wichtiger Eingriff!
• Lamelläre Keratoplastik:
Statt die gesamte Hornhaut zu transplantieren, können heute auch nur die erkrankten Schichten ersetzt werden.
Das schont gesundes Gewebe und führt zu schnellerer Genesung. Laser können hier u.a. helfen, die Schichten exakt zu schneiden.
• Künstliche Hornhaut-Implantate:
Neue, künstliche innere Hornhautschichten aus Hightech-Material (z.B. EndoArt®) ersetzen beschädigte Endothelzellen – ohne Spendergewebe. Das verkürzt die Heilungszeit und verringert das Risiko einer Abstoßung.
Corneal Cross-Linking:
Das Cross-Linking (auf Deutsch: Hornhautvernetzung) mit UV-A-Licht und Vitamin B2 (Riboflavin) ist eine Behandlung von hornhautverformenden Erkrankungen wie dem Keratokonus. Es hilft dabei, ein Fortschreiten zu stoppen; oft kann man so eine Transplantation vermeiden!
Siehe Abbildung 2: Corneal Cross-Linking
Zukunft
Limbale Stammzelltransplantation
Wenn die Hornhautoberfläche durch Krankheit oder Verletzung zerstört ist, können Stammzellen vom Rand der Hornhaut (Limbus) übertragen werden.
Sie erneuern das Hornhautgewebe und stellen eine klare Oberfläche wieder her.
Precise Vision Endothelial Keratoplasty (PVEK)
Vor kurzem wurde eine neue Methode vorgestellt – eine Kombination aus Zellbiotechnologie und 3D-Druck:
Die Zellen werden hier auf ein Kollagen-Gerüst gedruckt und bei der Operation eingesetzt!
Der Mangel an Spenderhornhäuten (weltweit gibt es 1 Hornhaut für 70 benötigte) kann durch diese neue Methode gelindert werden. Sie verbessert die Versorgung und optimiert die Ergebnisse für Patienten mit Hornhauterkrankungen deutlich.
Erste Versuche an Hasen-Augen
Das Kontrollkaninchen entwickelte nach 4 Wochen eine verdickte und vernarbte Hornhaut.
Im Vergleich dazu zeigten zwei PVEK-Kaninchen nach 4 Wochen eine klare und dünne Hornhaut.
Siehe Abbildung 3: Versuchskaninchen PVEK-Kaninchen
Wussten Sie schon?
--> Bei der Amniondeckung wird eine dünne Schicht der Fruchtblase wie ein natürliches Pflaster auf die Hornhaut gelegt – Sie schützt, lindert Entzündungen und fördert die Heilung!
Quellen:
Bilder: https://www.drzirm.org/ (Zugriff am 06.10.2025),
https://www.neuhann.de/patienteninformation/hornhauttransplantation-keratoplastik (Zugriff am 06.10.2025),
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/verfahren/crosslinking-201154 (Zugriff am 06.04.2025)
Lamis Baydoun, Isabel Dapena & Gerrit Melles MD, PhD, Current Treatment Options for Fuchs Endothelial Dystrophy, 2016
Tabibian et al. PACK-CXL: Corneal cross-linking in infectious keratitis. Eye Vis (Lond). 2016 Apr 19
Mimouni, M. (2024). 3D-Printed Ex Vivo-Expanded Endothelial Keratoplasty. Corneal Physician, Vol. 28, November 2024
Vom Lesestein zu Laser
Aleksandra Sedova, Julia Aschauer, Stefan Pieh / Spezialambulanz für Refraktive Chirurgie / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien / Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Die Anfänge: Erste optische Hilfen im Mittelalter
In Klöstern nutzten Mönche geschliffene Bergkristalle/Beryll als „Lesesteine“, die direkt auf den Text gelegt wurden und die Alterssichtigkeit ausglichen. Aus dem Wort „berille“ (Beryll) leitet sich „Brille“ ab – erst einzelne Linse („Brill“), später zwei gefasste Linsen.
Methoden der Refraktionsbestimmung
Früher: Probierbrille und Sehtafel, die Stärke wurde subjektiv bestimmt („besser mit A oder B?“); Genauigkeit hing stark von Erfahrung und Mitarbeit ab.
Heute: Autorefraktometer messen die Brechkraft objektiv in Sekunden; Wellenfront-Analyse erfasst auch feine Abbildungsfehler; Topo-/Tomographie vermisst Hornhaut, Vorderkammer und ggf. Linse – essenziell für refraktive OPs und Kontaktlinsenanpassung.
Die subjektive Feinanpassung bleibt der letzte Schritt zur besten korrigierten Sehschärfe.
Brillenentwicklung durch die Jahrhunderte
1290 - Nietbrille
Zwei Linsen, am Nasenrücken vernietet – schwer, aber die erste tragbare Brille.
(Siehe Abbildung 1)
1751 - Bügel-Brille / Ohrenbrille
Bügel hinter den Ohren → deutlich besserer Halt.
(Siehe Abbildung 2)
1784 – Bifokalbrille
Ein Glas mit Fern- und Nahteil.
(Siehe Abbildung 3)
1940er - Kunststoffgläser
Brillen werden leichter; 1980er – Titanfassungen erhöhen Komfort.
(Siehe Abbildung 4)
1959 – Gleitsichtbrille
Stufenloses Sehen ohne sichtbare Trennlinie.
(Siehe Abbildung 5)
Brillen Früher
- Schwere, runde Gläser
- Fassungen aus Metall oder Horn
- Keine Individualisierung, Einheitsgrößen
- Oft unbequem und wenig ästhetisch
Brillen Heute
- Leichte Fassungen aus Titan oder Kunststoff
- Dünne, hochbrechende Gläser
- Spezialbeschichtungen (Entspiegelung, Blaulichtfilter, Kratzschutz)
- Maßgeschneidert für Sehfehler, Komfort und Design
Revolutionäre Entwicklung: Die Kontaktlinse
1888 brachte Fick die ersten Glasschalen: wirksam, aber schwer und nur kurz tragbar.
1936 folgte PMMA – leichter, aber kaum sauerstoffdurchlässig.
1961 revolutionierten weiche Hydrogel-Linsen den Komfort; heute gibt es formstabile, hochsauerstoffdurchlässige Linsen, moderne weiche (inkl. torisch/multifokal) und Speziallinsen wie Ortho-K oder Sklerallinsen
(z. B. für Myopiekontrolle oder unregelmäßige Hornhäute).
Der Schritt zur Laserchirurgie
In den 1970/80ern versuchte die radiäre Keratotomie durch feine Schnitte die Hornhaut abzuflachen und Myopie zu reduzieren.
1983 hielt der Excimer-Laser Einzug: Er trägt Hornhautgewebe extrem präzise ab (~0,25 µm pro Puls).
1990 entstand LASIK (Flap + Excimer-Laser) und wurde zum Standard;
heute ergänzen SMILE (Lentikelextraktion) und phake Intraokularlinsen das Spektrum für individuell zugeschnittene Korrekturen.
Die Präzision des Excimer-Lasers liegt im Bereich von etwa 0,25 µm pro Puls – das entspricht 1/400 der Dicke eines menschlichen Haares!
Siehe Abbildung 6.
Wussten Sie schon?
--> Anfangs konnte nur Weitsichtigkeit durch Brillen korrigiert werden?
Brille, Kontaktlinse, Laser & Implantate
Julia Aschauer , Aleksandra Sedova , Stefan Pieh
Spezialambulanz für Refraktive Chirurgie / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien / Int. Leitung : Prof. Stefan Sacu
Brillen
Fassungen: ultraleicht aus Titan oder Kunststoff, bequemer Sitz.
Gläser: individuell dünn, entspiegelt, mit UV- oder Blaulicht-Filter (optional).
Myopie-Prävantion („myoper Defokus“): Mitte = scharf fürs Alltagssehen, Rand = gezielte leichte Unschärfe
→ kann das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern verlangsamen.
Kontaktlinsen
Weiche Linsen
- sehr komfortabel, große Auswahl
- bei hohen Hornhautverkrümmu ngen
- weniger präzise
- etwas höheres Infektionsrisiko als bei Brillen
Formstabile Linsen
- kleine, harte Linsen
- liefern auch bei unregelmäßigen Hornhäuten sehr scharfes Bild
- Eingewöhnung nötig
Sklerallinsen
- rößer, liegen auf der Lederhaut (Sklera) auf
- optimal bei stark verformten Hornhäuten
- aufwendiger in Handhabung
Cave: Infektionsrisiko: bei allen Linsen höher als bei Brillen!
Ortho-K (Orthokeratologie, Nachtlinsen):
- Formt die Hornhaut über Nacht → tagsüber scharfes Sehen ohne Brille/Linse.
- Verlangsamt Myopie (Augenlängenwachstum).
- Nachteil: erhöhtes Infektionsrisiko → strenge Hygiene Pflicht
Siehe Abbildung 1
Myope Defokus -Linsen
- Wie Defokus-Brillen: Kontrollzonen wechseln mit Korrektionszonen.
- Ergebnis: gutes Sehen + Bremsung des Längenwachstums → wirksam zur Myopiekontrolle.
Siehe Abbildung 2
Laser-Verfahren (Hornhaut-Chirurgie)
Excimer (193 nm, UV)
- Trägt Hornhaut in ~0,25 μm-Schritten ab.
- PRK/TransPRK: Oberfläche abtragen (TransPRK = „no-touch“); gut bei dünner Hornhaut. • PTK: Für Narben/oberflächliche Erkrankungen.
- Custom (Topo/Wellenfront): bei unregelmäßiger Hornhaut (z. B. Keratokonus-Folgen). • Achtung: Mindestdicke & Sicherheitsabstand zwingend.
Femtosekunden (IR)
- Schneidet Gewebe ultrapräzise.
- Femto-LASIK: Femto macht Flap, darunter Excimer.
- SMILE®: Minischnitt, Lentikel entfernen → gewebeschonend/stabil.
Siehe Abbildung 3 - Laserverfahren
Implantate (Phake IOL/ICL)
Zusatzlinse vor/ hinter der Iris – körpereigene Linse bleibt. Vorteil: geeignet bei sehr hoher Myopie/zu dünner Hornhaut, sehr gute Sehqualität, rückgängig machbar. Nachteil: Operation nötig, lebenslange Kontrollen
Conclusio
Brillen/KL: sicher & bewährt; Spezialdesigns (myoper Defokus, Ortho-K) können kindliche Myopie bremsen. Laserverfahren: sehr präzise, individuell planbar – Grenzen (v. a. Hornhautdicke) beachten.
Implantate: Option bei hohen Fehlsichtigkeiten. → Wahl immer individuell nach Auge, Fehlsichtigkeit und Sicherheit.
Wussten Sie schon, dass…
--> eine Brille das Fortschreiten einer Kurzsichtigkeit bremsen kann?
Vom Starstechen zur Hightech-Operation
Lisy Marcus, Victor Danzinger, Nikolaus Mahnert, Daniel Schartmüller & Christina Leydolt – Vienna IOL Study Group / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien / Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Einleitung
Die Kataraktchirurgie – die Operation des Grauen Stars – hat eine jahrtausendealte Geschichte. Von schmerzhaften frühen Methoden entwickelte sie sich zu einem der sichersten und häufigsten Eingriffe der modernen Medizin.
Das Starstechen – Antike bis 19. Jahrhundert
Die erste Behandlung war das sogenannte Starstechen:
- Ohne Betäubung und sehr schmerzhaft
- Die getrübte Linse wurde mit einer Nadel in den Glaskörper gedrückt
- Hohes Risiko für Entzündung, Infektion und Erblindung → Trotz der Gefahren blieb es über Jahrhunderte die einzige Therapie.
Harold Ridley & die erste Kunstlinse
Der britische Augenarzt Sir Harold Ridley (1906– 2001) gilt als Vater der modernen Kataraktchirurgie. Während des Zweiten Weltkriegs beobachtete er, dass Plexiglas-Splitter in Augen von Piloten gut vertragen wurden. Er erkannte das Potenzial des Materials (PMMA) für eine künstliche Linse und implantierte 1949 erstmals eine Intraokularlinse (IOL) in London. Seine Idee stieß zunächst auf Kritik, setzte sich jedoch durch und bildet heute die Grundlage für Millionen erfolgreicher Kataraktoperationen weltweit.
Siehe Abbildung 1: Harold Ridley
Die Geschichte der Biometrie
Nach Ridleys erster Kunstlinse stellte sich die Frage: Welche Linsenstärke ist die richtige? Ab den 1950ern wurden erste Messungen am Auge durchgeführt – Länge, Hornhautkrümmung und Vorderkammertiefe. Die frühen Berechnungsformeln waren ungenau, doch mit der Ultraschall-Biometrie (ab 1980) und später der optischen Biometrie (ab 1990) gelang eine präzise Berechnung. → Heute ermöglicht Biometrie eine exakte Vorhersage der Sehstärke – viele Patient:innen brauchen nach der Operation keine Brille mehr.
Siehe Abbildung 2: Geschichte der Biometrie
Die Entwicklung der modernen Phakoemulsifikation
1967 führte Charles Kelman die Phakoemulsifikation ein – inspiriert von einem Zahnarztbohrer.Mit Ultraschallvibrationen wurde die Linse in winzige Partikel zerteilt und abgesaugt.Der Eingriff konnte nun durch kleinste Schnitte erfolgen – Heilung schneller, Komplikationen seltener.In Kombination mit faltbaren Kunstlinsen wurde die Methode weltweit zum Standard.→ Über 20 Millionen Operationen jährlich – ein Beispiel, wie Innovation die Medizin revolutionieren kann.
Wussten Sie schon?
--> Der Graue Star ist weltweit die häufigste Ursache für Blindheit – aber auch die erfolgreichste Operation der modernen Medizin. Heute werden jährlich über 20 Millionen Kataraktoperationen durchgeführt, mit einer Erfolgsrate von über 95 %.
Quellen: https://www.srf.ch/wissen/gesundheit/behandlung-grauer-star-vom-riskanten-starstich-zur-routineoperation
https://ridleyeyefoundation.org/our-history/
Victor Danzinger, Lisy Marcus, Nikolaus Mahnert, Daniel Schartmüller & Christina Leydolt – Vienna IOL Study Group / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien
Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Was ist die Presbyopie?
Presbyopie ist ein natürlicher Alterungsprozess der Linse, der meist ab dem 40. Lebensjahr auftritt. Durch den Elastizitätsverlust kann sich die Linse nicht mehr ausreichend verformen – nahe Objekte erscheinen unscharf. Eine Lesebrille oder Gleitsichtbrille gleicht dies typischerweise aus.
Presbyopie-Korrektur bei der Grauen-Star-Operation
Moderne Intraokularlinsen (IOL) können die Presbyopie mitkorrigieren und die Brillenabhängigkeit deutlich reduzieren. Multifokale Linsen (Trifokal-IOL): Mehrere Brennpunkte für Ferne, Mitte und Nähe → hohe Brillenunabhängigkeit, aber mögliche Halos und Blendungen.
EDOF-Linsen (Extended Depth of Focus): Erweiterte Tiefenschärfe mit weniger bei der Kataraktoperation Nebeneffekten → natürlicheres Sehen, ggf. Lesebrille für Naharbeit.
Forschung: perfekte Presbyopie-Korrektur
Die aktuelle Forschung zielt auf bessere Sehqualität und weniger optische Nebenwirkungen:
Multifokale Designs: KI-gestützte Spiraloptiken für sanftere Übergänge und besseren Kontrast. EDOF-Linsen: Maximierte Tiefenschärfe bei geringer Blendempfindlichkeit.
Mix & Match: Kombination unterschiedlicher Linsentypen für individuelle Sehbedürfnisse. Akkommodierende IOLs: Zukünftige Linsen, die die natürliche Fokussierung der jungen Linse nachahmen – aktuell noch in Entwicklung.
Vienna IOL Study Group
Gegründet 1996 an der Medizinischen Universität Wien, widmet sich die Wiener IOL-Studiengruppe der Weiterentwicklung der Kataraktchirurgie. Ziel: Verbesserung von Qualität, Sicherheit und Komfort durch klinische Studien zu neuen Operationsmethoden, Geräten und Intraokularlinsen – stets nach höchsten wissenschaftlichen Standards.
Abbildung 1: Multifokale Intraokularlinse.
Trifokales Design mit drei Brennpunkten für Nähe (≈40 cm), Mitte (≈60–80 cm) und Ferne.
Abbildung 2: Kerntrübung und Rindentrübung links und Diffraktive Multifokale Intraokularlinse rechts.
Konzentrische Ringsegmente ermöglichen scharfes Sehen in Nähe, Mitte und Ferne nach der Grauen-Star-Operation.
Abbildung 3: EDOF (Extended Depth of Focus) Intraokularlinse.
Spezielles Design für erweiterte Tiefenschärfe – ermöglicht scharfes, kontinuierliches Sehen von Ferne bis Zwischenbereich.
Abbildung 4: Vienna IOL Study Group
(von links): Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Christina Leydolt, Dr. Marcus Lisy, Dr. Victor Danzinger, Priv.-Doz. Dr. Daniel Schartmüller, Dr. Nikolaus Mahnert, Leonie Barth BSc.
Wussten Sie schon?
--> Spezielle innovative Linsen ermöglichen die Korrektur der Altersweitsichtigkeit während der Grauen-Star-Operation, wodurch brillenfreies Sehen erreicht werden kann.
Quellen/Abbildungen:
Rampat R, Gatinel D. Multifocal and Extended Depth-of-Focus Intraocular Lenses in 2020. Ophthalmology. 2021
zeiss.com/meditec/en/products/iols/trifocal-iols/at-lisa-tri-family
iol.meduniwien.ac.at/clinical-trials
bvimedical.com/products/isopure
Stefan Steiner, Sophie Riedl, Stephan Szegedi, Barbara Kiss, Clemens Vass
Spezialambulanz für Glaukom / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien / Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Medikamentöse Therapie
Augentropfen sind meist die erste Wahl in der Glaukombehandlung. Sie senken den Augeninnendruck, indem sie den Abfluss des Kammerwassers verbessern oder die Produktion von Kammerwasser verringern. Mehrere Wirkstoffgruppen stehen zur Verfügung, darunter Prostaglandin-Analoga, Betablocker, Alpha-2-Agonisten, Carboanhydrasehemmer und Rho-Kinase-Inhibitoren. Häufig werden Kombinationen eingesetzt, um die Wirkung zu verstärken. → Wirksam, gut verträglich und therapieabhängig von Zuverlässigkeit und Verträglichkeit des Patienten.
Lasertherapie
Eine Option bei unzureichender Wirkung oder Unverträglichkeit von Tropfen.
Lasertrabekuloplastik: verbessert den Abfluss über das Trabekelwerk.
Laseriridotomie: kleine Öffnung in der Iris, v. a. bei Engwinkelglaukom.
Zyklophotokoagulation: senkt die Kammerwasserproduktion über das Ziliarkörpergewebe.
→ Ziel ist die Drucksenkung ohne chirurgischen Eingriff.
Chirurgische Therapie
Die Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie am AKH Wien bietet ein breites Spektrum moderner chirurgischer Verfahren zur Behandlung des Glaukoms an.
Minimalinvasive Glaukomchirurgie
Geeignet für leichte bis mittlere Glaukome oder in Kombination mit einer Kataraktoperation. Ermöglicht eine moderate Drucksenkung bei geringerem Risiko und schnellerer Erholung. → Nicht für sehr fortgeschrittene Stadien geeignet.
Siehe Abbildung 1 - Beispiel eines minimalinvasiven Eingriffes im Kammerwinkel: Exzision des Trabekelmaschenwerkes mittels einem Speziellen Instrument (Kahook Dualblade) zur Verminderung des Abflusswiderstandes im Trabekelmaschenwerk.
Trabekulektomie und Drainageimplantate
Eingesetzt, wenn Medikamente und Laser nicht mehr ausreichen. Ziel ist eine stärkere Drucksenkung, um das Fortschreiten der Sehnervschädigung zu stoppen. → Aufwändiger Eingriff mit Risiken wie Infektionen oder Vernarbungen, aber oft letzte Option zur Seherhaltung.
Siehe Abbildung 2: Beispiel eines Preserflo MicroShunts, der Kammerwasser in ein zuvor angelegtes Sickerkissen ableitet.
Wussten Sie schon?
--> Neben der medikamentösen Therapie des Glaukoms besteht auch die Möglichkeit einer Behandlung mittels Laser oder chirurgischer Eingriffe
Quellen:
1) Steiner S, Vass C. Praxis der nichtfiltrierenden minimalinvasiven Glaukomchirurgie [Insights into the practice of minimally invasive glaucoma surgery]. Klin Monbl Augenheilkd. 2025 May;242(5):585-604. German. doi: 10.1055/a-2217-6851. Epub 2025 Jan 14. PMID: 39809442.
2) Sadruddin O, Pinchuk L, Angeles R, Palmberg P. Ab externo implantation of the MicroShunt, a poly (styrene-block-isobutylene-block-styrene) surgical device for the treatment of primary open-angle glaucoma: a review. Eye Vis (Lond). 2019 Nov 15;6:36.
Ioanna Dimakopoulou, Markus Ritter, Georgios Mylonas, Michael Georgopoulos, Prof. Stefan Sacu - Spezialambulanz für Vitreoretinale Chirurgie / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien / Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Die Zeit vor Gonin (vor 1920)
Erste Beschreibungen im 19. Jh. (Ware, Wardrop, Panizza). Mit dem Ophthalmoskop (Helmholtz, 1850) wurden Netzhautrisse erstmals erkannt. Trotz vieler Versuche blieb die Erkrankung unheilbar – bis Jules Gonin um 1920 den Zusammenhang zwischen Riss und Ablösung entdeckte.
Was ist eine Netzhautablösung?
Die Netzhaut löst sich von ihrer Unterlage und verliert ihre Versorgung – unbehandelt droht Erblindung.Hauptursache ist ein Riss, durch den Flüssigkeit eindringt.
Formen:
- Rhegmatogen (Riss)
- Traktional (Zugkräfte, z. B. bei Diabetes)
- Exsudativ (Flüssigkeit) Warnzeichen: Lichtblitze, schwarze Punkte („Rußregen“), „Vorhang“ im Gesichtsfeld.
Siehe Abbildung 1 - Netzhautablösung
Moderne Netzhautchirurgie - ab 1920
Jules Gonin erkannte, dass Risse in der Netzhaut die Ursache sind, und verschloss sie zunächst mit Hitze. 1938 konnte man mit einer Luftblase im Auge die Netzhaut wieder anlegen. Später entwickelte man die „Plombe“ und die „Cerclage“, bei der ein Band um das Auge gelegt wird. Ab 1965 nutzte man extreme Kälte (Kryopexie), was das Gewebe schonte und die Eingriffe sicherer machte.
Abbildungen 2–4: Historische Operationsmethoden der Netzhautchirurgie – Ignipunktur nach Gonin, Koagulationen nach Larsson und Einführung der intraokularen Luftblase durch Rosengren.
Durchbruch in der Netzhautchirurgie: Vitrektomie und Laser seit 1973
Die Pars-plana-Vitrektomie ermöglichte das Entfernen des Glaskörpers und beseitigte Zugkräfte und Blutungen. Mit dem Laser konnten Risse präzise versiegelt werden. → Heute sind über 90 % aller Netzhautablösungen erfolgreich behandelbar.
MedUni Wien: Pionierarbeit bei Netzhautablösungen seit 1972
Die I. Universitäts-Augenklinik Wien gründete 1972 eine Spezialambulanz für Netzhautablösungen. Frühe Nachsorge und Forschung machten Wien zu einem internationalen Zentrum der Netzhautchirurgie.
Zeitliche Entwicklung
Vor 1920: Blindheit fast sicher (Erfolg 0 %)
1929: Ignipunktur: Erste Heilungen
1938: Luftblase als innere Tamponade
1953: Plombe: Eindellung der Sklera
1957: Cerclage: Ringförmige Stabilisierung
1965: Kryopexie: Kälte statt Hitze
1973: Vitrektomie & Laserkoagulation - Moderne Standardmethoden (Erfolg > 90 %)
Wussten Sie schon?
--> Die Netzhautablösung galt über Jahrhunderte als unheilbar. Erst im 20. Jahrhundert machten mutige Pioniere entscheidende Fortschritte, die bis heute das Sehvermögen von Millionen Menschen retten.
Quellen:
Kreissig, Ingrid. (2016). Primary retinal detachment: A review of the development of techniques
for repair in the past 80 years. Taiwan Journal of Ophthalmology. 6. 10.1016/j.tjo.2016.04.006.
Jakob Kraiger, Sam Hedo, Markus Ritter, Georgios Mylonas, Michael Georgopoulos, Prof. Stefan Sacu, Spezialambulanz für Vitreoretinale Chirurgie / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien / Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Was kann an der Netzhaut kaputtgehen?
Netzhautablösung
Durch ein Loch gelangt Flüssigkeit unter die Netzhaut und sie hebt sich ab („die Tapete löst sich“), so trennt sich die Netzhaut von der Aderhaut. Folgen sind Schattensehen, Gesichtsfeldausfälle und – unbehandelt – Erblindung. Siehe Abbildung 1.
Makulaloch / epiretinale Membran
Ein kleines zentrales Loch in der Makula, oft altersbedingt durch Zug des Glaskörpers an der Netzhaut, führt zu erheblichen Sehstörungen. Siehe Abbildung 2.
Folge von Diabetes oder Gefäßkrankheiten
Erhöhter Blutzucker schädigt die feinen Netzhautgefäße. Es führt zu undichten Gefäßen – Blut und Flüssigkeiten treten in die Netzhaut aus. Ähnliche Schäden, wie Blutungen oder Unterversorgungen, treten bei retinalen Venen- oder Arterienverschlüssen auf.
Wie hilft die Netzhautchirurgie heute?
Minimal-invasive Operationen: Über winzige Zugänge wird der Glaskörper entfernt und die Netzhaut wieder angelegt (Vitrektomie).
Netzhaut mit Gas oder Öl anlegen: Nach Versiegelung des Lochs mit Laser oder Kälte wird der Augapfel mit Luft, Gas oder Öl gefüllt, um die Netzhaut von innen anzulegen.
Laserbehandlungen: Laser versiegelt Netzhautlöcher und stoppt das Wachstum neuer, schädlicher Gefäße.
Siehe Abbildung 3
Chancen für Patient:innen
Dank moderner Netzhautchirurgie sind viele Erkrankungen heute gut behandelbar. Netzhautablösungen können in rund 90 % der Fälle erfolgreich operiert werden. Neue Operationstechniken ermöglichen eine schnelle Erholung – oft in wenigen Tagen bis Wochen. Auch wenn die volle Sehkraft nicht immer zurückkehrt, lässt sich das Augenlicht meist erhalten oder verbessern.
Aktuelle Innovationen
Mikrochirurgie mit hochauflösenden Kameras: Hochauflösende 3D-Kameras ermöglichen präzisere Eingriffe ohne Mikroskopblick.
Siehe Abbildung 4
Roboter Assistenz für höchste Präzision: Roboterarme führen feinste Bewegungen vibrationsfrei aus – für höchste Genauigkeit.
Intraoperatives OCT an der MedUni Wien: Unsere Mikroskope verfügen über integriertes OCT – so kann die Netzhaut in Echtzeit während der Operation beurteilt werden.
Abbildung 5: Beispiel für ein Intraoperatives OCT
Wussten Sie schon?
--> Die Netzhaut ist die innere Schicht des Auges – sie wandelt Lichtreize in elektrische Nervenimpulse um, die das Gehirn zu Bildern verarbeitet. Wie der Film einer Kamera!
Quellen:
Leica Microsystems
Kanskis Klinische Ophthalmologie. Ein systematischer Ansatz, 8. Auflage, Brad Bowling, Seite 526
Kashani et al. Surgical Method for Implantation of a Biosynthetic Retinal Pigment Epithelium Monolayer for Geographic Atrophy: Experience from a Phase 1/2a Study. Ophthalmol Retina. 2020 Mar;4(3):264-273. doi: 10.1016/j.oret.2019.09.017.
Sam Hedo, Jakob Kraiger, Gregor Reiter, Bilal Haj Najeeb, Günther Weigert, Wolf Bühl, Prof. Stefan Sacu
Ambulanz für Diagnostik und Therapie von Makulaerkrankungen / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien / Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Wie Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) das Leben verändert
Die AMD führt zu einem Verlust des zentralen Sehens und erschwert somit Alltagsaktivitäten wie das Lesen, Anziehen und Autofahren. Dies führt häufig zu Einsamkeit, sozialem Rückzug, Angst und depressiver Verstimmung. Patienten haben eine hohe Sturzgefahr, die öfters zu Krankenhausaufenthalten aufgrund Brüche oder anderer gefährlicher Verletzungen führt.
Siehe Abbildung 1 - Links normales Sehen. Rechts: Das Sehen bei fortgeschrittener AMD
Quelle: Augenmedizin.at – Krankheitsbilder. Verfügbar unter: https://augenmedizin.at/krankheitsbilder (Zugriff am 29.09.2025).
Laser-Photokoagulation: Erste Behandlungsmethode bei AMD
- Ende der 1970er Jahre erstmals erprobt.
- Prinzip: Ein hochenergetischer Laserstrahl wirdgezielt auf die erkrankte Netzhautregion gelenkt. Der Laser erzeugt Hitze („Koagulation“), die krankhafte Gefäßneubildungen zerstört.
- Probleme:
- Auch gesundes Netzhautgewebe wird geschädigt.
- Besonders im Zentrum (Makula) führte dieBehandlung oft zu sofortiger Verschlechterung der Sehschärfe.
- • Langzeit-Ergebnisse:
- Kurzfristig Sehverlust nach der Behandlung.
- Nach 2 Jahren: Patienten mit Lasertherapie hatten bessere Sehleistungen als jene ohne Behandlung.
Siehe Abbildung 2 - Laser-Photokoagulation
Photodynamische Therapie (PDT)
- Ende der 1990er Jahre eingeführt
- Ablauf:
- Lichtempfindlicher Wirkstoff (Verteporfin) wird über eine Vene verabreicht und sammelt sich in krankhaften Gefäßen der Netzhaut.
- Aktivierung durch schwaches Laserlicht → Gefäße werden gezielt verschlossen.
- Vorteil: Gesundes Gewebe bleibt weitgehend erhalten.
- ABER: Fortschreiten der AMD wird nur verlangsamt, nicht gestoppt
Siehe Abbildung 3: Schematische Darstellung der photodynamischen Lasertherapie (PDT)
Quelle: (Yoo, Kim et al. 2022)
Anti-VEGF-Therapie – Sehen bewahren durch gezielte Behandlung
- Bei der feuchten AMD wachsen krankhafte, undichte Blutgefäße an der Netzhaut, welche zu Flüssigkeitsansammlungen und Blutungen führen, die das scharfe Sehen einschränken.
- Man hat herausgefunden, dass ein Botenstoff namens VEGF dieses Gefäßwachstum antreibt.
- Die Lösung:
- Spezielle Medikamente – sogenannte Anti- VEGF-Wirkstoffe – blockieren diesen Botenstoff.
- Die Medikamente werden direkt ins Auge injiziert.
- Das Wachstum der neuen Gefäße stoppt und Flüssigkeit und Blutungen bilden sich zurück.
- Das Ergebnis: Viele Patienten sehen wieder besser!
Siehe Abbildung 4 - Anti-VEGF-Therapie
Zeitlicher Entwicklungsverlauf
1852: Die ersten Beschreibungen der AMD, allerdings noch unter einem anderen Namen
1855: Die erste Beschreibung von Drusen durch den niederländischen Augenarzt F.C. Donders
1910: Der Wiener Ophthalmologe Ernst Fuchs beschrieb die Erkrankung erstmals detailliert
1970er: Entstehung des Begriffs „AMD“, frühe Experimente der Strahlentherapie und chirurgische Versuche
1970-1980: Laser- Photokoagulation: Erste Therapie, sehr destruktiv
1999: Photodynamische Therapie: weniger destruktiv
2005: Anti-VEGF- Therapie: Revolution in der Routine- Behandlung
Wussten Sie schon?
--> Noch vor 50 Jahren gab es keine wirksame Behandlung!
Heute können wir vielen Menschen das Sehen erhalten oder sogar verbessern!
Quellen:
Argon Laser Photocoagulation for Neovascular Maculopathy: Five-Year Results From Randomized Clinical Trials. Arch Ophthalmol. 1991;109(8):1109–1114. doi:10.1001/archopht.1991.01080080069030
Photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization in age-related macular degeneration with verteporfin: one-year results of 2 randomized clinical trials--TAP report. Treatment of age-related macular degeneration with photodynamic therapy (TAP) Study Group. Arch Ophthalmol. 1999 Oct;117(10):1329-45. Erratum in: Arch Ophthalmol 2000 Apr;118(4):488. PMID: 10532441.
(Rosenfeld, Brown et al. 2006) DeepPDT-Net: predicting the outcome of photodynamic therapy for chronic central serous chorioretinopathy using two-stage multimodal transfer learning. Sci Rep. 2022 Nov 4;12(1):18689. (Yoo, Kim et al. 2022)
Sophie Frank-Publig, Gregor Reiter, Klaudia Birner, Julia Mai, Sophie Riedl, Prof. Stefan Sacu
Vienna Clinical Trial Center Ophtalmology, Optima – Ophtalmic Image Analysis, Christian Doppler Forschungsgesellschaft / Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Warum ist die altersbedingte Makuladegeneration immer noch so wichtig?
Die altersbedingte Makuladegeneration ist wichtig, weil sie in den Industrieländern die häufigste Ursache für schweren Sehverlust im höheren Lebensalter darstellt. Schon heute sind weltweit über 200 Millionen Menschen betroffen – Tendenz steigend durch die alternde Bevölkerung!
Forschung für Ursachen
Wissenschaftler entdecken immer mehr Gene und Entzündungsprozesse, die mit AMD zusammenhängen. Dadurch können in Zukunft gezieltere Therapien entstehen. Lebensstil: Nahrungsergänzung (AREDS2), eine gesunde Ernährung (Mittelmeerküche) oder ein spezielles Diabetes-Medikament können das Fortschreit-Risiko verringern.
Neues in der Therapie
Komplementsystem-Inhibitoren: Lange gab es bei der Geografischen Atrophie keine Behandlung. Jetzt gibt es Mittel, die das Fortschreiten verlangsamen können. Neue Medikamente wie Pegcetacoplan und Avacincaptad Pegol, wurden 2023 in den USA zur Therapie zugelassen.
Verbesserte Therapien für feuchte AMD: Bereits bekannte Spritzen ins Auge werden weiterentwickelt. Einige neue Medikamente müssen nur noch alle paar Monate gegeben werden, statt alle paar Wochen!
Automatische Messung von Flüssigkeit
Siehe Abbildung 1 - Automatische Messung von Flüssigkeit
Hier hat ein Algorithmus, der bei uns entwickelt wurde, 3 Formen der Flüssigkeitsansammlung in der AMD auf Bildern der optischen Kohärenztomographie automatisch ausgewertet.
Formen der Erkrankung auf neuen Geräten
Die Krankheit beginnt mit der Entstehung von Drusen. Das sind Ablagerungen von Abbaustoffen.
Später entsteht die Geografische Atrophie, wo die Zellen der Netzhaut absterben, oder die feuchte Form, wo leckende Gefäße Flüssigkeit absondern und sogar Blutungen und Narben entstehen können.
Wir wissen mittlerweile, dass alle Formen Hand in Hand gehen: Drusen, Flüssigkeit und Atrophie können gleichzeitig auftreten!
Siehe Abbildung 2: Formen der Erkrankung
Forschungsschwerpunkt an der MUW Augenklinik: Künstliche Intelligenz
Wir entwickeln Computer-Modelle, die Augenbilder automatisch analysieren und helfen die Krankheit besser zu verstehen. Außerdem hilft die KI Ärzt:innen bei der Behandlung! Aber wofür wird sie angewendet?
1. Früherkennung und Diagnose: Veränderungen in Augenbildern können automatisch erkannt werden, somit wird die AMD jetzt oft früher festgestellt!
2. Vorhersage - Kann die KI in die Zukunft sehen? Ja! Durch genaue Risiko-Einschätzung wird vorhergesagt, wie sich die Krankheit bei einer einzelnen Person entwickeln wird. Dadurch lässt sich die Behandlung individueller planen!
3. Unterstützung bei der Therapie: Durch Risiko-Einschätzung und Flüssigkeitsmessungen kann man die Belastung für Betroffene reduzieren. Aber die Entscheidung bleibt am Ende immer bei den Ärzt:innen!
4. Forschung und neue Erkenntnisse: Die KI wird auch eingesetzt, um neue Zusammenhänge zu entdecken– zum Beispiel kleine Veränderungen im Gewebe, die man auch auf Bildern erkennen kann.
Wussten Sie schon?
--> Künstliche Intelligenz kann heutzutage kleine Veränderungen im Auge besser erkennen als erfahrene Fachärzte!
Quellen: Mai et al. Comparison of Fundus Autofluorescence Versus Optical Coherence Tomography-based Evaluation of the Therapeutic Response to Pegcetacoplan in Geographic Atrophy. Am J Ophthalmol. 2022 Dec;244:175-182.
Schlegl et al. Fully Automated Detection and Quantification of Macular Fluid in OCT Using Deep Learning. Ophthalmology. 2018 Apr;125(4):549-558.
Frank-Publig & Birner et al. Artificial intelligence in assessing progression of age-related macular degeneration. Eye (Lond). 2025 Feb;39(2):262-273.
Spaide et al. Consensus Nomenclature for Reporting Neovascular Age-Related Macular Degeneration Data: Consensus on Neovascular Age-Related Macular Degeneration Nomenclature Study Group. Ophthalmology. 2020.
Heiko Stino, Kim Lien Huber, Paul Widmann-Sedlnitzy, Laura Kunze, Andreas Pollreisz
Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien
Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Hintergrund
Die Fluoreszenzangiographie (FLA) ist der Goldstandard zur Beurteilung der Netzhautgefäße: Ein Farbstoff wird intravenös injiziert, die Verteilung über ~10 Minuten fotografiert. So lassen sich Gefäßneubildungen, Undichtigkeiten und Areale ohne Durchblutung auch in der Peripherie sicher darstellen. Nachteile sind die Invasivität, der Zeitaufwand und seltene Nebenwirkungen.
Optische Kohärenztomographie Angiographie
Die OCT-Angiographie (OCTA) misst Blutfluss ohne Farbstoff, indem die gleiche Stelle mehrfach gescannt und Bewegung im Gefäßlumen detektiert wird. Sie ist schnell, nicht-invasiv und schichtet die Netzhaut in Plexus auf. Limitationen: kleineres Sichtfeld als FLA und mögliche Artefakte bei langen Scans oder Augenbewegungen.
Abbildung 1: Patient mit proliferativer DR, multiplen Proliferationen & Minderperfusion
Errungenschaften der Universitätsklinik für Augenheilkunde & Optometrie Wien
Gemeinsam mit der MedUni Wien wurde ein Widefield-OCTA-Prototyp entwickelt (≈15 s Aufnahme, Bilddurchmesser ~18 mm). Dieses System erlaubt eine rasche, hochqualitative, nicht-invasive Gefäßdarstellung der gesamten Netzhaut, inklusive Peripherie. Darauf aufbauend konnten mehrere klinische Projekte erfolgreich umgesetzt werden.
Abbildung 2: Patient mit proliferativer DR, OCTA (A) mit B-Scan (b) und FLA (C)
Detektion von Proliferationen
Für die Diagnose der proliferativen diabetischen Retinopathie ist das Erkennen von Neovaskularisationen entscheidend. Mit der Widefield-OCTA gelang in 95 % der Fälle die richtige Diagnosestellung; kleine Gefäßanomalien lassen sich oft detailreicher zeigen als mit FLA. Damit eignet sich die Methode besonders für Screening und Verlauf.
Abbildung 3: Nicht-durchblutete Areale (gelb) in zunehmenden DR Stadien (von links nach rechts)
Kombination mit Fundusfotographie
Die Verknüpfung von Farbfundusbildern mit Widefield- OCTA erlaubt eine mehrschichtige Analyse: Struktur (Foto) und Perfusion (OCTA) werden deckungsgleich beurteilt. Das erleichtert das Mapping von Läsionen, das Monitoring unter Therapie und die Kommunikation mit Patient:innen.
Nicht-durchblutete Areale
Mit Fortschritt der Erkrankung nehmen Nichtperfusionszonen zu und bedrohen die Netzhautversorgung. Widefield-OCTA macht diese Areale in allen Stadien sichtbar und quantifizierbar. So können Risikoabschätzungen und Therapieanpassungen (z. B. Panretinale Laserung) gezielter erfolgen.
Abbildung 4: Farbfotographie (links) & OCTA (rechts) desselben Patienten
Wussten Sie schon?
--> Bei der OCTA kann man durch die die Bewegung der roten Blutkörperchen die Gefäße der Netzhaut darstellen!
Quellen:
1. Stino H, Niederleithner M, Iby J, Sedova A, Schlegl T, Steiner I, Sacu S, Drexler W, Schmoll T, Leitgeb R, Schmidt-Erfurth UM, Pollreisz A. Detection of diabetic neovascularisation using single-capture 65°-widefield optical coherence tomography angiography. Br J Ophthalmol. 2023 Dec 18;108(1):91-97.
2. Stino H, Huber KL, Niederleithner M, Mahnert N, Sedova A, Schlegl T, Steiner I, Sacu S, Drexler W, Schmoll T, Leitgeb R, Schmidt-Erfurth U, Pollreisz A. Association of Diabetic Lesions and Retinal Nonperfusion Using Widefield Multimodal Imaging. Ophthalmol Retina. 2023 Dec;7(12):1042-1050.
Philipp Fuchs, Adrian Reumüller, Reinhard Told, Birgit Lackner, Roman Dunavölgyi
Spezialambulanz für Ophthalmologische Onkologie und Okuloplastik
Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien
Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Einleitung
Unsere Augenlider schützen die Hornhaut, verteilen Tränenflüssigkeit und prägen das Aussehen. Die Lidchirurgie hat sich von einfachen Eingriffen zu hochpräziser Okuloplastik entwickelt.
Was ist Okuloplastik?
Okuloplastik (oder okuloplastische Chirurgie) befasst sich mit Operationen an den umgebenden Strukturen des Auges – Lidern, Tränenwegen und Augenhöhle. Sie umfasst funktionelle, rekonstruktive und ästhetische Eingriffe und hat das Ziel, Funktion, Schutz und natürliches Aussehen des Auges zu erhalten oder wiederherzustellen.
Früher: Traditionelle Ansätze
Im 19. Jahrhundert waren Eingriffe oft radikal, Rekonstruktionen selten. Fehlstellungen wie Entropium oder Ektropium führten zu Schmerzen, Hornhautschäden und Sehverlust. Kosmetische Aspekte spielten kaum eine Rolle – entscheidend war das Überleben des Auges.
Heute: Moderne Okuloplastik
Heute werden Funktion und Ästhetik gleichermaßen berücksichtigt. Tumore werden schonend entfernt, Lider präzise rekonstruiert, Fehlstellungen korrigiert. Minimal-invasive Techniken, Laser und biokompatible Materialien ermöglichen natürliche und funktionelle Ergebnisse.
Wenn das Auge entfernt werden muss
Bei schweren Verletzungen, Infektionen oder Tumoren ist manchmal eine Enukleation nötig. Dabei wird der Augapfel entfernt, Muskeln und Lider bleiben erhalten.
Ein Implantat ermöglicht Bewegung und eine natürlich wirkende Prothese – wichtig für Lebensqualität und Selbstbild.
Abbildung 1: Augenprothese – Kunstauge
Tränenwege & Operation
Die Tränenwege leiten Flüssigkeit in die Nase. Bei Verengung hilft eine Sondierung mit Silikonschlauch, der sie während der Heilung offenhält.
Abbildung 2: Abfluss der Tränenflüssigkeit über Punktum, Kanälchen und Tränensack in die Nase
Forschung & Innovation an der MedUni Wien
• Entwicklung neuer OP-Techniken
• Forschung zu Biomaterialien für schonende Rekonstruktionen.
• Internationale Vorreiterrolle durch Zusammenarbeit (Onkologie, Plastische Chirurgie, Radiologie)
Zeitlicher Entwicklungsverlauf
1812: Wien: Erste Universitäts- Augenklinik
1859: Arlt (Wien): Kontrollierte Enukleation
1874: Arlt (Wien): Wimpern- Transplantation
1882: Ernst Fuchs (Wien): Enukleation als Standardtherapie des intraokularen Melanoms
1884: Knapp (Wien): Klassische Enukleationstechnik unter lokaler Betäubung
2025: Okuloplastik nach neuestem Stand und evidenzbasierte klinische Forschung
Wussten Sie schon?
--> Fehlstellungen wie Entropium (Lid nach innen gedreht) können unbehandelt zur Erblindung führen.
--> Moderne Lidchirurgie verbindet Funktion & Ästhetik – kaum Narben und schnelle Heilung.
Quellen:
•Arlt CF. Transplantation des Cilienbodens. In: Graefe A, Saemisch T (Hrsg.). Handbuch der gesamten Augenheilkunde. Bd. 3(1). Leipzig: Wilhelm Engelmann; 1874. S. 447–451.
•Jelcic I, Zoranovic U, Karaman K, et al. Carl Ferdinand von Arlt, Ritter von Bergschmidt (1812–1887): A Pioneer in Ophthalmology. Acta Medica Academica. 2019;48(3):332-336. doi:10.5644/ama2006-124.276.
•Fuchs E. Das Sarcom des Uvealtractus. Wien: Wilhelm Braumüller; 1882. (Bibliografischer Nachweis)
•https://www.medizin.uni-tuebingen.de/cache/images/c/8/2/7/e/c827ed54d99fd1f669a29c2267fa4e05f2c50177.jpeg
Wassermann L., Rezar-Dreindl S., Neumayer T., Schwarzenbacher L. und Stifter E. Spezialambulanz für Strabismus, Kinderophthalmologie und pädiatrische Ophthalmochirurgie / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien
Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Die Einführung des Mutter-Kind-Pass
Mit der Einführung des Mutter-Kind-Passes im Jahr 1974 und dem begleitenden Vorsorgeprogramm konnten die Säuglings- und Müttersterblichkeit in Österreich innerhalb weniger Jahre deutlich gesenkt werden. Zum Programm gehören auch mehrere Augenuntersuchungen:
- Zum 1. Geburtstag prüft der Kinderarzt den äußeren Augenabschnitt, die Beweglichkeit und den Parallelstand der Augen (Brückner-Test).
- Zum 2. Geburtstag erfolgt eine ausführliche Augenfachuntersuchung mit Sehschärfetest, orthoptischem Status, und Refraktionsbestimmung (in Cycloplegie), um Fehlsichtigkeiten wie Myopie, Hyperopie oder Anisometropie frühzeitig zu erkennen.
- Ziel dieser Untersuchungen ist es, Augenerkrankungen früh zu erkennen und rechtzeitig zu behandeln, um die Sehentwicklung zu sichern und Amblyopie vorzubeugen.
Abbildung 1: Die Einführung des Mutter-Kind-Pass
Was bedeutet Amblyopie eigentlich und welche Risikofaktoren/Ursachen gibt es?
Unter Amblyopie versteht man eine Schwachsichtigkeit, die nicht durch eine organische Erkrankung verursacht wird. Das Auge selbst ist gesund, jedoch wird das Sehen im Gehirn unzureichend trainiert. Sie kann einseitig oder beidseitig auftreten und betrifft weltweit etwa 0,2–5 % der Bevölkerung. Risikofaktoren sind u.a. Frühgeburt, Entwicklungsverzögerung, familiäre Vorbelastung und Sehfehler wie Schielen oder Fehlsichtigkeit. Ursachen können Trübungen (z. B. Katarakt), starke Brechungsfehler (Myopie, Hyperopie, Astigmatismus, Anisometropie) oder eine Ptosis sein. Wird das betroffene Auge über längere Zeit nicht richtig benutzt, bleibt es funktionell schwach.
Abbildung 2: Amblyopie und Risikofaktoren
Therapie der Amblyopie
Die Behandlung zielt darauf ab, das schwächere Auge zu fördern.
Okklusionstherapie: Das besser sehende Auge wird stundenweise mit einem Pflaster abgedeckt, um das schwächere Auge zu trainieren.
Korrektur von Ursachen: Fehlsichtigkeiten werden mit Brille oder Kontaktlinse behandelt, eine Ptosis oder ein Schielen bei Bedarf früh operiert.
Die Dauer der Therapie hängt vom Alter und Schweregrad ab (meist 1–6 h täglich bis zum 10. Lebensjahr). Regelmäßige Kontrollen sind entscheidend, um das gesunde Auge nicht zu überlasten.
Abbildung 3: Therapie der Amblyopie
Trend der Prävalenz von Amblyopie bei österreichischen Wehrpflichtigen, geboren zwischen 1965 und 2003
In einer Analyse von 1,7 Millionen österreichischen Wehrpflichtigen (Jahrgänge 1965–2003) zeigte sich ein deutlicher Rückgang der Amblyopieprävalenz nach Einführung des MKP: von etwa 4 % auf nur 1,5 % bis 2001.Diese Entwicklung unterstreicht den großen Erfolg des österreichischen Vorsorgeprogramms und die Bedeutung früher ophthalmologischer Kontrollen im Kindesalter.
Abbildung 4: Die Grafik zeigt einen eindeutigen Rückgang der einseitigen und beidseitigen Sehbeeinträchtigung nach Einführung des Screening Programms (die gesamte Gruppe und dann jeweils die einzelnen Gruppen mit unterschiedlichen Visus-Grenzen).
Wussten Sie schon?
--> 2024 hat der Mutter-Kind-Pass sein 50igstes Jubiläum gefeiert und wurde 1974 von der Gesundheitsministerin Ingrid Leodolter eingeführt.
Quellen:
1. (https://www.medmedia.at/gyn-aktiv/eine-einzige-erfolgsgeschichte/)
2. BUI QUOC et al - Amblyopia: A review of unmet needs, current treatment options, and emerging therapies
j.survophthal.2023.01.001. Epub 2023 Jan 18.
3. Fu et al, Global prevalence of amblyopia and disease burden projections through 2040: a systematic review and meta-analysis 2019 Br J Ophthalmol 2020 Aug;104(8):1164-1170.
4. Holmes et al- A randomized trial of prescribed patching regimens for treatment of severe amblyopia in children Ophthalmology 2003 Nov;110(11):2075-87. doi: 10.1016/j.ophtha.2003.08.001.
5. The Pediatric Eye Disease Inbestigator Group - A randomized trial of patching regimens for treatment of moderate amblyopia in children Arch Ophthalmol. 2003;121:603-611
6. Wassermann et al - Trend of prevalence of amblyopia in Austrian conscripts born between 1965 and 2003 – a descriptive study – 09/2025 submitted
Frühgeborenenretinopathie – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Rezar-Dreindl S., Neumayer T., Wassermann L., Schwarzenbacher L. und Stifter E.
Spezialambulanz für Strabismus, Kinderophthalmologie und pädiatrische Ophthalmochirurgie mit Frühgeborenen Augenambulanz / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien
Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Augenerkrankungen im Kindesalter
Weltweit sind rund 19 Millionen Kinder von Sehschwäche oder Erblindung betroffen (WHO). Die häufigste Ursache ist die Frühgeborenenretinopathie. Weitere Ursachen: Linsentrübungen, Hornhaut- und Sehnervenerkrankungen sowie erbliche Netzhauterkrankungen.
Siehe Abbildung 1: Schematische Darstellung des Auges
Frühgeborenenretinopathie – was ist das?
Die Retinopathia praematurorum (RPM) betrifft die Netzhaut unreifer Frühgeborener. Da sich die Netzhautgefäße erst bis zur Geburt vollständig entwickeln, kann es durch Frühgeburt zu abnormalem Gefäßwachstum und Netzhautschädigung kommen. Faktoren, die in der Entstehung der RPM eine Rolle spielen sind ein niedriges Geburtsgewicht und Schwangerschaftswoche bei Geburt sowie die künstliche Beatmung mit erhöhtem Sauerstoffanteil. Die Häufigkeit der RPM variiert je nach Land/ Region, Zugang zum Gesundheitssystem sowie nach Zugang zu geeigneten Screeningmethoden. Die Häufigkeit hängt stark von Versorgungsstandard und Screening ab.
Vergangenheit
1942 erstmals beschrieben („retrolentale Fibroplasie“). Durch Fortschritte in der neonatologischen Versorgung kamen immer mehr Kinder mit niedrigerem Geburtsgewicht und Schwangerschaftswoche zur Welt. Damit stieg die Zahl der Frühgeborenen mit PRM und sie wurde zur häufigsten Ursache von Sehbeeinträchtigung und Erblindung im Kindesalter weltweit.
Heute gilt: Je geringer das Geburtsgewicht, desto höher das Risiko. 1986 wurde die Kältetherapie (Kryotherapie) als erste Behandlung etabliert – sie reduzierte die Erblindungsrate deutlich.
Gegenwart
Seit den 1990er-Jahren wird die Lasertherapie eingesetzt, seit 2019 zusätzlich VEGF-hemmende Medikamente, die in den Glaskörper injiziert werden.
Abbildung 2: Applikation von Medikamenten in den Glaskörperraum (intravitreale Injektion)
Entscheidend bleibt die frühe Diagnose: Alle Kinder mit <32. Schwangerschaftswoche oder <1500 g Geburtsgewicht werden regelmäßig gescreent. → Dank moderner Methoden ist die ROP heute gut behandelbar, schwere Sehschäden sind selten.
Abbildung 3: Beispiele von einen Frühgeborenen RPM; Bilder aufgenommen mit einer Funduskamera. Links: typisches Bild einer behandlungsbedürftigen RPM, rechts: nach Behandlung der peripheren Netzhaut mittels Laser
Zukunft und Forschung
Forschung an der MedUni Wien zeigt: Von 352 Frühgeborenen entwickelten 41 % eine RPM, 5 % benötigten eine Behandlung. Jedes zusätzliche Gramm Geburtsgewicht senkte das Risiko um 0,4 %. Mit neuen Verfahren wie der OCT- Angiographie (OCTA) können Netzhautgefäße nicht- invasiv und präzise dargestellt werden. → Ziel: Frühere Erkennung, bessere Therapie, langfristiger Erhalt der Sehkraft.
Abbildung 4. Links: Die Aufnahme mittels OCTA zeigt die zentralen Netzhautgefäße eines reif geborenen Kindes; Rechts: ein Frühgeborenes der 27. Schwangerschaftswoche mit einem Geburtsgewicht von 950g. Es zeigen sich deutliche Unterschiede der Gefäßarchitektur.
Wussten Sie schon?
--> Global gesehen ist die Frühgeborenenretinopathie die häufigste vermeidbare Ursache für Erblindung im Kindesalter
Quellen:
1. Terry TL. Retrolental fibroplasia. J Pediatr. 1946;29(6):770-773.
2. Gilbert C. Retinopathy of prematurity: a global perspective of the epidemics, population of babies at risk and implications for control. Early Hum Dev. 2008;84(2):77-82.
3. Kong, L. et al. An update on progress and the changing epidemiology of causes of childhood blindness worldwide. J. Am. Assoc. Pediatr. Ophthalmol. Strabismus JAAPOS 2012
4. Wood, S, et al. 80 Years of vision: Preventing blindness from retinopathy of prematurity. J. Perinatol. 2021
5. Sabri, K. et al. Retinopathy of Prematurity: A Global Perspective and Recent Developments. Pediatrics 2022
6. Blazon MN, Rezar-Dreindl S, Wassermann L., Neumayer T, Berger A, Stifter E. Retinopathy of Prematurity: Incidence, Risk Factors, and Treatment Outcomes in a Tertiary. Care Center. JCM 2024
7. Rezar-Dreindl S, Eibenberger K, Told R, Neumayer T, Steiner I, Sacu S, Schmidt-Erfurth U, Stifter E. Retinal vessel architecture in retinopathy of prematurity and healthy controls using swept-source optical coherence tomography angiography. Acta Ophthalmol. 2021 Mar; 99(2).
Sophie Frank-Publig
Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien
Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Mythos 1: Alle Babys werden mit blauen Augen geboren
Bei der Geburt wirken manche Augen blau, weil das Pigment Melanin noch nicht vollständig ausgebildet ist. Innerhalb des ersten Lebensjahres kann sich die Augenfarbe verdunkeln, wenn mehr Melanin eingelagert wird.
Mythos 2: Babys haben bei der Geburt schon ausgewachsene Augen
Neugeborene Augen sind etwa zwei Drittel so groß wie Erwachsenenaugen. Sie wachsen vor allem in den ersten
Lebensjahren und noch einmal in der Pubertät. Somit ändert sich auch die Brechkraft. Meist stabilisiert sich das Sehvermögen im Jugendalter oder frühen Erwachsenenalter (ungefähr mit 18–21 Jahren) – bis dann die altersbedingte Weitsichtigkeit (Presbyopie) ab Mitte 40 einsetzt.
Mythos 3: Zwei braunäugige Eltern können kein blauäugiges Kind bekommen
Die Augenfarbe hängt nicht nur von einem oder zwei Genen ab, sondern von bis zu 16. Deshalb kann ein Kind auch eine ganz andere Augenfarbe haben als beide Eltern.
Mythos 4: Karotten verbessern die Sehkraft
Karotten enthalten Vitamin A, das wichtig für gesundes Sehen ist. Aber: Schon kleine Mengen reichen! Vitamin A steckt auch in Spinat, Grünkohl, Milchprodukten oder Fisch. Mehr Karotten machen die Augen also nicht besser, und eine Brille ersetzt das Gemüse auch nicht. Wichtig: Vitamin A wird besser aufgenommen, wenn man es mit Fett isst.
Mythos 5: Augengymnastik macht die Augen besser
Übungen ändern weder Sehschärfe noch verhindern sie eine Brille. Nur bei bestimmten
Problemen, etwa wenn beide Augen nicht gut zusammenarbeiten, können Übungen helfen.
Mythos 6: In die Sonne starren ist gesund
Im Gegenteil: Schon wenige Sekunden können die Netzhaut dauerhaft schädigen oder sogar zur Erblindung führen. Normale Sonnenbrillen schützen hier nicht – dafür braucht es spezielle Filter, die eine ISO-Norm erfüllen.
Mythos 7: Wenn man schielt, bleiben die Augen so
Die Augenmuskeln können sich frei bewegen – Schielen entsteht durch Krankheiten, falsche
Sehkorrektur oder Nerven-/Muskelschäden, nicht durchs absichtliche Schielen.
Mythos 8: Nur Jungen können farbenblind sein
Frauen sind zwar seltener betroffen, aber auch sie können farbenblind sein.
Mythos 9: Farbenblinde sehen nur schwarz-weiß
Die meisten sehen Farben – aber falsch oder eingeschränkt, z. B. Rot- und Grüntöne schwer
unterscheidbar. Komplettes „Graustufen-Sehen“ ist selten.
Mythos 10: Zu nah am Fernseher sitzen schadet den Augen
Es ist anstrengend und kann Kopfschmerzen machen, aber es schädigt die Augen nicht. Kinder sitzen oft näher dran, weil sie in der Nähe besser fokussieren können. Wer dauerhaft sehr nah sitzt, könnte allerdings kurzsichtig sein.
Mythos 11: Lesen bei schlechtem Licht macht die Augen kaputt
Nein – es strengt nur mehr an. Mit guter Beleuchtung ermüden die Augen langsamer.
Mythos 12: Computerarbeit ruiniert die Augen
Bildschirme schaden nicht direkt, können aber trockene oder müde Augen verursachen. Tipp: Alle 20 Minuten in die Ferne schauen, regelmäßig blinzeln und künstliche Tränen nutzen!
Mythos 13: Feine Druckschrift oder viel Naharbeit verschlechtern die Augen
Die Augen nutzen sich dadurch nicht ab, aber sie werden müde. Pausen helfen.
Mythos 14: Wer Brille oder Kontaktlinsen trägt, macht sich abhängig
Die Brille verschlechtert das Sehen nicht, sondern entlastet die Augen.
Mythos 15: Eine falsche Brillenstärke schädigt die Augen
Das schadet nicht dauerhaft, kann aber Kopfschmerzen oder verschwommenes Sehen verursachen – verschwindet aber, sobald man die Brille abnimmt.
Mythos 16: Lernschwierigkeiten kommen von Sehproblemen
Ursache sind Störungen in der Verarbeitung im Gehirn, nicht die Augen. Schlechte Augen können aber wie eine Lernstörung wirken – daher Augen checken lassen, wenn Kinder in der Schule Probleme haben.
Mythos 17: Sehverschlechterung gehört zum Alter dazu
Nicht unbedingt: Viele Probleme wie Altersweitsichtigkeit oder grauer Star sind behandelbar. Regelmäßige Kontrollen sind wichtig, um Krankheiten wie grünen Star oder
Makuladegeneration früh zu erkennen.
Mythos 18: Ein grauer Star muss „reif“ sein, bevor er operiert wird
Heute kann die getrübte Linse schon entfernt werden, sobald sie beim Sehen stört.
Mythos 19: Man kann Augen transplantieren
Das geht nicht – das Auge ist über den Sehnerv mit dem Gehirn verbunden. Dieser Nerv besteht aus über einer Million Fasern, die sich nicht wieder zusammenfügen lassen. Transplantieren lässt sich aber die Hornhaut (der klare Teil vorne).
Mythos 20: Alle Augenuntersuchungen sind gleich
Augenärzt:innen (Ophthalmolog:innen): studierte Mediziner mit bis zu 12 Jahren Ausbildung, dürfen Medikamente aufschreiben und Operationen durchführen
Orthoptist:innen: 3-jähriger Fachhochschul-Abschluss, ihre Expertise liegt in der Erkennung, Behandlung und Vermeidung von Sehstörungen, Schielen oder Augenbewegungsstörungen.
Optiker:innen: fertigen und passen Brillen oder Kontaktlinsen an, basierend auf den Rezepten der anderen Fachleute. Sie haben auch eine spezielle Ausbildung oder Lehre abgeschlossen.
Quelle: American Academy of Ophthalmology: 20 Eye and Vision Myths - American Academy of Ophthalmology, Zugegriffen am 26.09.2025
Sophie Riedl, Stefan Steiner, Stephan Szegedi, Barbara Kiss, Clemens Vass
Spezialambulanz für Glaukom / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien / Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Ist das der Grüne Star?
Schon Hippokrates verwendete im antiken Griechenland den Begriff Glaucosis für „meergrüne Augen“, ohne zwischen verschiedenen Ursachen wie Linsentrübung (Katarakt) zu unterscheiden. 1622 beschrieb Richard Banister erstmals den „harten Augapfel“. 1722 unterschied Michel Brisseau Glaukom und Linsenerkrankungen. Die genauen Ursachen dieser unterschiedlichen Erkrankungen blieben jedoch bis ins 19. Jahrhundert unbekannt.
Schauplatz: Sehnerv
Glaukom ist eine Gruppe von Erkrankungen, die den Sehnerv schädigen. Dieser leitet Informationen von den Sehzellen ans Gehirn, wo das Bild entsteht. Wird der Sehnerv geschädigt, entstehen Gesichtsfeldausfälle, die ohne Behandlung bis zur Erblindung führen können.
Abbildung 1: Fortschreiten des Gesichtsfeldausfalls: Anfangs ist das Gesichtsfeld normal, mit einem kleinen blinden Fleck. Mit der Zeit breiten sich bogenförmige Ausfälle aus und können schließlich fast das ganze Gesichtsfeld betreffen.
Therapie
Bereits entstandene Schäden am Sehnerv können nicht rückgängig gemacht werden.
- Ziel der Therapie ist es, das Fortschreiten des Glaukoms zu bremsen.
- Meist werden Augentropfen eingesetzt, die den Augendruck senken. Diese müssen regelmäßig angewendet und nicht eigenständig abgesetzt werden.
- Zusätzlich sind Laserbehandlungen oder – bei Bedarf – Operationen möglich.
- Neue Verfahren und Medikamente, die den Sehnerv schützen sollen, werden derzeit erforscht.
Risiko: Augeninnendruck
Meist schädigt ein erhöhter Augeninnendruck den Sehnerv. Doch auch bei normalem Druck kann ein Glaukom auftreten – vermutlich durch eine gestörte Durchblutung des Sehnervs.
Abbildung 2: Kammerwasser. Es fließt in der vorderen Augenkammer. Wenn Produktion und Abfluss nicht im Gleichgewicht sind, steigt der Augeninnendruck.
Was kann ich tun?
Die Erkrankung bleibt oft lange unentdeckt!
Glaukom bleibt oft lange unbemerkt, weil die Ausfälle zunächst am Rand des Gesichtsfelds liegen und das Gehirn sie ausgleicht. In Westeuropa ist es die zweithäufigste Ursache für
Erblindung – deshalb ist Vorsorge wichtig!
Daher ist Vorsorge wichtig!
Ab 40 Jahren werden schmerzlose Untersuchungen empfohlen: Messung des Augeninnendrucks, Augenspiegelung, Gesichtsfeldtest und OCT zur Beurteilung des Sehnervs.
Rücksprache bei Medikamenten
Informieren Sie Ihre Augenärztin oder Ihren Augenarzt über Medikamente wie Cortison oder Mittel gegen Reizblase, da sie den Augendruck erhöhen können.
Wussten Sie schon?
--> Früherkennung rettet Sehkraft! Glaukom tut meist nicht weh und kann gerade deshalb unbemerkt bleiben!
Kim Lien Huber, Paul Widmann-Sedlnitzky, Laura Kunze, Heiko Stino, Bianca Gerendas, Katharina Kriechbaum, Andreas Pollreisz / Spezialambulanz für Diabetische Retinopathie / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien / Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Was ist die diabetische Retinopathie?
Die diabetische Retinopathie (DRP) ist eine Folgeerkrankung von Diabetes Mellitus, bei der hohe Blutzuckerwerte die kleinen Blutgefäße der Netzhaut schädigen. Sie wird in folgende Stadien eingeteilt:
- Milde DRP: Kleine Gefäßausbuchtungen (Mikroaneurysmen)
- Moderate DRP: Mehr geschädigte Gefäße, kleine Blutungen
- Schwere DRP: Viele Gefäße sind geschädigt → die Netzhaut bekommt zu wenig Sauerstoff
- Proliferative DRP: Wegen Sauerstoffmangel bildet das Auge neue, sehr instabile Gefäße. Diese können ins Auge bluten oder die Netzhaut abheben → Gefahr für bleibenden Sehverlust.
=> Das diabetische Makulaödem kann in jedem Stadium auftreten!
Lange keine spürbaren Symptome! Erst bei Komplikationen wie Makulaödem, Glaskörperblutung oder Netzhautablösung kommt es zu unscharfem Sehen, verzogenen Linien oder Flecken im Gesichtsfeld.
Abbildung 1: Normalbefund (oben) und Makulaödem (unten)
Optische Kohärenz Tomografie (OCT) eines diabetischen Makulaödems: Diese Komplikation der diabetischen Retinopathie wird durch Flüssigkeitsaustritt verursacht und führt zu einer Schwellung (Ödem) des Sehzentrums (Makula)
Behandlung
- Laserkoagulation
- Chirurgische Entfernung des Glaskörpers
- Injektionstherapie ins Auge:
- Hemmung des Wachstumsfaktors VEGF:
- Ranibizumab (Lucentis®)
- Aflibercept (Eylea®)
- Faricimab (Vabysmo®
- Cortison-Präparate:
- Triamcinolon
- Dexamethason Implantat (Ozurdex®)
- Hemmung des Wachstumsfaktors VEGF:
Rasanter Anstieg von Diabeteserkrankungen weltweit
Abbildung 2: Rasanter Anstieg von Diabeteserkrankungen weltweit
Abbildung 3: Floureszenz-Angiographie (links) und Fundusfotographie (rechts) eines Auges
Floureszenz-Angiographie (links) und Fundusfotographie (rechts) eines Auges mit proliferativer diabetischen Retinopathie: Zu sehen sind zahlreiche Blutungen, wild wachsende neue Gefäße (Neovaskularisationen) sowie Areale mit mangelnder Durchblutung (Ischämie)
Was kann ich selbst dagegen tun?
- Sorgfältige Einstellung des Blutzuckers!
- Regelmäßige Augenuntersuchgen beim niedergelassenen Augenfacharzt
- Keine bis milde diabetischen Veränderungen im Auge: 1x/ Jahr
- Moderate Veränderungen: alle 6 Monate
- Schwere Veränderungen: alle 3 Monate
- Proliferative Veränderungen: engmaschige Kontrollen
- Blutdruck und Blutfette regelmäßig kontrollieren
- Gesunder Lebensstil: Bewegung, Nichtrauchen, gesunde Ernährung
Notfall – Wann sofort in die Augenklinik?
- Plötzlicher Sehverlust oder Sehverschlechterung
- Lichtblitze im Auge oder Schwarze Punkte „Rußregen“
- Schleier oder „Vorhang“ im Gesichtsfeld
Wussten Sie schon?
--> Das Gefährliche an der diabetischen Retinopathie ist, dass lange keine spürbaren Symptome auftreten -> Erblindungsgefahr!
Quellen:
Pollreisz, Andreas et al. “Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle der diabetischen Augenerkrankung (Update 2023)”. Wiener klinische Wochenschrift vol. 135,Suppl 1 (2023): 195-200. doi:10.1007/s00508-022-02119-7IDF Diabetes Atlas;, 9te Edition 2019 https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133351_IDFATLAS9e-final-web.pdf
Judith Kreminger, Adrian Reumüller, Reinhard Told, Birgit Lackner, Roman Dunavölgyi
Spezialambulanz für Ophthalmologische Onkologie und Okuloplastik / Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien / Int. Leitung: Prof. Stefan Sacu
Vom harmlosen Muttermal bis zu lebensbedrohlichen Melanomen
Am Auge können gut- oder bösartige Tumoren entstehen. Bösartige Tumoren wie das Aderhautmelanom können Metastasen bilden und müssen behandelt werden. Gutartige Tumoren sind meist harmlos, können aber das Sehen beeinträchtigen. Moderne Therapien ermöglichen oft den Erhalt von Auge und Sehkraft.
Historische Entwicklung
Früher Standard
Enukleation: die Entfernung des Auges: Früher musste bei bösartigen Augentumoren oft das ganze Auge entfernt werden – das rettete Leben, aber das Sehvermögen ging verloren.Auch heute ist diese Operation manchmal nötig. Danach kann jedoch eine Prothese eingesetzt werden, die das Auge äußerlich fast natürlich aussehen lässt.
Beginn des 20. Jhdt
Bestrahlung mit Plättchen: Ärzt:innen nähten kleine radioaktive Plättchen auf das Auge, um den Tumor gezielt zu bestrahlen. So konnte das Auge erhalten und die Lebensqualität deutlich verbessert werden.
Heute
Telebestrahlung: Moderne Strahlentherapie: Heute kann die Strahlung gezielt von außen ins Auge gelenkt werden. So lassen sich auch größere oder schwierig gelegene Tumoren wirksam behandeln. In den letzten 100 Jahren hat sich die Therapie stark verändert – von der Entfernung des Auges bis zur präzisen Protonenbestrahlung. Heute sind schonende und sehr genaue Behandlungen möglich.
Stand der Wissenschaft
Moderne Bildgebung – ins Auge schauen wie nie zuvor
Mit OCT können Ärzt:innen tief ins Auge blicken – fast wie in eine Gewebeschicht. So lassen sich Tumoren genau erkennen und ihre Struktur präzise beurteilen.
Unser Forschungsprojekt – DREAM OCTA
Mit der neuen Technik können gutartige Gefäßtumoren schnell und berührungslos untersucht werden – ähnlich wie bei einem Foto. Ziel ist es, längere und unangenehme Untersuchungen zu vermeiden.
Abbildung 1: Moderne Bildgebung
Abbildungen 2 und 3: In den Bildern ist der Tumor mit roten Kreisen eingezeichnet.
Wussten Sie schon?
--> Aderhaut-Melanome sind die häufigsten Tumoren im Erwachsenenalter.
--> Viele Augen-Tumoren können heute augenerhaltend behandelt werden.
--> Seit 2024 ist erstmals in Österreich nur am AKH Wien Protonenbestrahlung für Augen-Tumore möglich.
Markus Ritter, Bianca Gerendas, Joanna Dimakopoulo, Sabine Motschiunig, Prof. Stefan Sacu
Ambulanz für erbliche Netzhauterkrankungen - Elektrophysiologie
Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Medizinische Universität Wien
Einleitung
Erbliche Netzhauterkrankungen entstehen durch Veränderungen im Erbgut. Sie betreffen die lichtempfindliche Netzhaut und können schrittweise das Sehen verschlechtern.
Was sind erbliche Netzhauterkrankungen?
Die Netzhaut besteht aus Sinneszellen – Stäbchen und Zapfen. Genveränderungen können ihre Funktion stören. Die Erkrankung beginnt oft früh und schreitet langsam fort.
Häufige Formen: Retinitis pigmentosa – Nachtblindheit und später Tunnelblick. Morbus Stargardt – Sehverlust im Zentrum schon im Jugendalter.
Abbildung 1: Erbliche Netzhauterkrankungen
Diagnose
Die Abklärung erfolgt in spezialisierten Ambulanzen. Augenuntersuchungen und Bildgebung (z. B. OCT oder Fundusfotografie) zeigen typische Veränderungen. Das Elektroretinogramm (ERG) misst die Netzhautaktivität. Sehtests prüfen Sehschärfe, Farben und Gesichtsfeld. Gentests identifizieren die Mutation und unterstützen bei Beratung und Studien.
Fundusfotografie
Mit speziellen Kameras kann die Netzhaut genau aufgenommen werden. So werden Veränderungen sichtbar und der Krankheitsverlauf gut dokumentiert.
Ultraweitwinkelbildgebung: Diese moderne Netzhautfotografie zeigt bis zu 80 % der Netzhaut – meist ohne Pupillenerweiterung. So können auch äußerste Bereiche erkannt werden, die sonst leicht übersehen werden.
Abbildung 2: Fundusfotografie
Elektroretinogramm (ERG)
Das ERG misst die elektrische Aktivität der Netzhaut – ähnlich wie ein EKG fürs Herz. Nach Pupillenerweiterung werden feine Elektroden aufgesetzt und Lichtreize gegeben. So zeigt das ERG, ob Stäbchen (für Nachtsehen) oder Zapfen (für Farbsehen) geschädigt sind.
Abbildung 3: Elektroretinogramm
Gentherapie – ein Blick in die Zukunft
Bei der Gentherapie wird ein gesundes Gen in die Netzhautzellen eingebracht, um fehlerhafte Erbinformation zu ersetzen. Dafür nutzt man harmlose Viren als „Transportmittel“. Die Behandlung erfolgt durch eine einmalige Injektion unter die Netzhaut.
2017 wurde mit Luxturna® die erste Gentherapie für das RPE65-Gen zugelassen – ein großer Fortschritt. In Wien wurde die erste Behandlung in Österreich durchgeführt.
Neue Studien und Techniken wie CRISPR/Cas geben Hoffnung auf weitere gezielte Therapien.
Abbildung 4: Verabreichung und Wirkungsweise von Voretigene Neparvovec
Bildquelle: ABCA4, ATP-binding cassette family A transporter member 4; LRAT, lecithin retinol acyltransferase; RDH, retinol dehydrogenase; RPE, retinal pigment epithelium. LUXTURNA [package insert]. Philadelphia, PA: Spark Therapeutics, Inc., 2017.
Abbildung 5: Progressiver Sehverslust aus Patientensicht bei RPE65-assoziierte Netzhautdystrophie
Wussten Sie schon?
--> Über 270 Gene können Netzhauterkrankungen verursachen.
--> Weltweit sind mehr als 2 Millionen Menschen von Retinitis pigmentosa betroffen.
--> Erste Gentherapien sind in Europa zugelassen – ein Meilenstein für Betroffene.