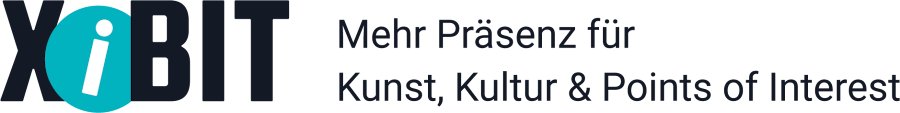Vor der Brailleschrift
Ich lese. Ich schreibe. Ich bin.
Ein Gang durch die Geschichte der taktilen Schrift
Der Ausstellungsraum „Vor der Brailleschrift“ verbindet historische Objekte mit menschlichen Geschichten. Er zeigt, dass die Suche nach einer tastbaren Sprache mehr war als technische Erfindung – sie war Ausdruck des Wunsches nach Teilhabe, Bildung und Selbstbestimmung.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Kommunikation funktionieren konnte, bevor es eine standardisierte Punktschrift gab. Jedes Objekt erzählt von einer Etappe auf dem Weg zur Erfindung der Brailleschrift und verdeutlicht den menschlichen Erfindungsgeist, Barrieren zu überwinden.
Objekt 1 – Quipus: Tastbare Kommunikation vor der Schrift
Den Anfang bildet ein außergewöhnliches Artefakt aus Südamerika. Die Quipus – Knoten- und Schnursysteme der Inka – dienten zur Aufzeichnung von Informationen und wurden sowohl visuell als auch haptisch genutzt. Diese ersten tastbaren Informationssysteme sind frühe Zeugnisse einer inklusiven Kommunikationsform, die schon im 7. Jahrhundert n. Chr. existierte.
Objekt 2 – Zeitliche Entwicklung der Blindenschrift
Eine chronologische Darstellung führt durch drei Jahrhunderte der Ideenentwicklung: vom 17. Jahrhundert mit Francesco Lana di Terzi über Valentin Haüy und Johann Wilhelm Klein bis hin zu Charles Barbier und Louis Braille. Sie zeigt, wie technische, pädagogische und gesellschaftliche Veränderungen zur Entstehung einer neuen Schriftkultur beitrugen.
Objekt 3 – Francesco Lana Terzi und das Terzi-Alphabet
Der Jesuit Francesco Lana Terzi entwarf bereits 1670 ein Schriftkonzept mit Linien und Punkten, die in Papier geprägt wurden, um sie fühlbar zu machen. Terzi schlug auch Hilfsmittel zur „Handführung“ vor – eine Methode, die bis heute beim Schreiben von Menschen mit Blindheit Anwendung findet. Sein System gilt als erster dokumentierter Versuch einer tastbaren Schrift, auch wenn es nie praktisch umgesetzt wurde.
Objekt 4 – Reliefschrift und erhabene Buchstaben
Reliefschriften, Profilschriften und erhabene Zeichen waren frühe Versuche, Schrift für blinde Menschen lesbar zu machen. Sie orientierten sich an der Schwarzschrift und wurden vereinfacht fühlbar dargestellt. Verschiedene Materialien wie Metall, Holz oder Draht kamen zum Einsatz. Diese Phase zeigt den Übergang von handwerklichen Experimenten zu didaktischen Systemen – und verdeutlicht, wie eng Schrift, Technologie und Inklusion verbunden waren.
Objekt 5 – Valentin Haüy und der Prägedruck
Der Franzose Valentin Haüy gründete 1784 in Paris die erste Blindenschule der Welt. Seine Beobachtung, dass Druckbuchstaben im Papier tastbar werden, führte zur Erfindung der Prägeschrift. Haüy prägte Buchstaben so, dass sie mit den Fingern lesbar waren, und entwickelte die „Haüy noire“, eine geschwärzte Prägeschrift, die auch für Sehende lesbar blieb. Dieses Objekt markiert den Beginn des systematischen Unterrichts für Menschen mit Blindheit.
Objekt 6 – Die Stachelschrift von Johann Wilhelm Klein
Im Jahr 1807 entwickelte der Wiener Pädagoge Johann Wilhelm Klein die sogenannte Stachelschrift. Feine Nadeln wurden spiegelverkehrt ins Papier gestochen und erzeugten tastbare Buchstabenpunkte. Obwohl das Lesen mühsam war, stellte Kleins Schrift einen wichtigen Schritt dar – sie war sowohl für blinde als auch sehende Menschen lesbar.
Objekt 7 – Charles Barbier und die Nachtschrift
Der französische Artilleriehauptmann Charles Barbier erfand 1815 eine Punktschrift aus zwölf Punkten, um Soldaten Nachrichten bei Dunkelheit lesen zu lassen. Dieses System inspirierte den jungen Louis Braille, der die komplexe Struktur vereinfachte und die heute weltweit gebräuchliche 6-Punkt-Schrift entwickelte. Barbier gilt damit als entscheidender Wegbereiter der modernen Blindenschrift.
Quipus ist ein faszinierendes Artefakt, das den Völkern Südamerikas als Kommunikationsmittel diente. Es handelt sich dabei um ein komplexes System aus Knoten und Schnüren. Auf einer Hauptschnur sind mehrere Neben- oder Anhängeschnüre mit Knoten befestigt. Länge und Art der Knoten sowie Farben stehen für verschiedene Informationen.
Vor der Eroberung der Spanier wurden diese von den Völkern der Andenregion und den Inkas für die Aufzeichnung von Mengen, geschichtlichen Dokumentationen und Übermittlung von Nachrichten verwendet.
Ihr Ursprung geht auf das 7. Jahrhundert n. Chr. zurück, sie dienten aber noch bis ins 17. Jahrhundert in abgelegenen Andenregionen als visuelles sowie tastbares Kommunikationsmittel.
Quipus waren die ersten taktilen Informationssysteme, die auch von Menschen mit Blindheit dechiffriert werden konnten.
Zeitliche Entwicklung der Blindenschrift
17. Jahrhundert
1670 Vorschlag von Francesco Lana di Terzi (Italien) für eine Blindenschrift, die nie benutzt wurde (Terzi-Alphabet)
18. Jahrhundert
- 1784 Valentin Haüy gründet das erste Blindeninstitut der Welt in Paris
- 1786 Herstellung des ersten Buches in Blindenschrift (Haüy-Alphabet)
19. Jahrhundert
- 1804 Gründung der ersten deutschsprachigen Blindenschule in Wien durch Johann Wilhelm Klein
- 1806 Gründung der ersten deutschen Blindenschule in Berlin-Steglitz durch Johann August Zeune
- 1807 Stachelschrift von Johann Wilhelm Klein (Wien)
- 1809 Louis Braille wird in Coupvray bei Paris geboren
- 1815 Charles Barbier entwickelt die erste Punktschrift (Sonographie) als militärische Nachtschrift
- 1819/1820 Charles Barbier stellt seine Sonographie dem Pariser Blindeninstitut vor
- 1825 Vorstellung der 6-Punktschrift von Louis Braille (Entwicklung 1821 - 1825)
10. Dezember 1631 - 22. Februar 1687
Katholischer Priester des Jesuitenordens. Entwarf bereits im 17. Jahrhundert ein Luftschiff und in seinem Buch: „Vorbote oder Versuch [Essay] über einige neue Erfindungen im Vorfeld der Hauptkunst“ beschreibt er in einem Kapitel „Auf welche Weise ein Blindgeborener nicht nur schreiben lernen, sondern auch unter einer Chiffre seine Geheimnisse verbergen und die Antworten in denselben Chiffren verstehen kann“.
Sein Vorschlag war, die Buchstaben in ein System von Linien zu übersetzen und mit Punkten zu kennzeichnen und diese in ein Papier zu prägen, damit sie für Menschen mit Blindheit tastbar waren. Er gab auch den Ratschlag, wenn blinde Menschen die Schrift der Sehenden schreiben wollten, Saiten oder Drähte zu benutzen, damit die Linie gehalten werden konnte. Er war damit auch der Erfinder der „Handführung“, die heute in abgewandelter Form von Menschen mit Blindheit zum Beispiel bei der Unterschrift angewandt wird. Das System von Terzi war die erste aus erhabenen Punkten und Strichen bestehende Schrift, die von Menschen mit Blindheit gelesen werden konnte. Sie wurde aber nie in der Praxis eingesetzt.
Das Terzi-Alphabet
Francesco Lana di Terzi - 1670, Italien
Im italienischen Original-Alphabet fehlen die Buchstaben J, K, W, X und Y.
Abbildung 1: Das Terzi-Alphabet
Taktile Darstellung von Buchstaben, Zeichen oder Mustern, die mit den Fingern ertastet werden und auch mit den Augen gelesen werden können. Im Gegensatz zu den Punktschriften orientiert sich diese an der Schwarzschrift, die vereinfacht grafisch dargestellt wird. Vor der Erfindung des Buchdrucks gab es nur eine handgeschriebene
Schrift, die für Menschen mit Blindheit weder fühlbar war, noch die Möglichkeit bestand, diese zu schreiben, da eine Kontrolle des Geschriebenen nicht möglich war. Auch die gedruckte Schwarzschrift konnte nicht gelesen werden, da sie nicht erhaben war. Es wurde die Ansicht vertreten, dass die Nichtsehenden die Schreibschrift erlernen sollten. Hintergrund war, dass man der Meinung war, ein eigenes System, welches nur von diesen Menschen benutzt wurde, einer Stigmatisierung, einer Ausgrenzung gleichkommen würde. Diese These wurde aber wieder bald verworfen, da die Umsetzung in der Praxis scheiterte. Erst durch die Erfindung des Buchdrucks um 1450 durch Johannes Guttenberg war es möglich, schriftliche Werke in vielfach gedruckter Auflage zu reproduzieren.
Spiegelverkehrte, in Metall gegossene Buchstaben, bewegliche Lettern, waren 200 Jahre später Anregung, auch für Menschen mit Blindheit ein System der Prägeschrift zu entwickeln, bei der die Buchstaben nicht spiegelverkehrt auf der Rückseite des Papiers eingepresst wurden, sondern erhaben und taktil wahrnehmbar auf der Vorderseite lesbar waren. Bevor dieses System in der Blindenbildung eingesetzt wurde, gab es aber noch viele andere Versuche. Blechbuchstaben oder aus Draht geformte Zeichen beziehungsweise Buchstaben aus Holz wurden verwendet, um Wörter sowie ganze Texte zu vermitteln.
Die älteste Blindenschule der Welt, die Institution Royale des Jeunes Aveugles, heute Institut National des Jeunes Aveugles in Paris wurde 1784 von Valetin Haüy gegründet. Er unterrichtete einen Jugendlichen mit Blindheit, Francois Le Sueur, und lehrte ihn mit Holzbuchstaben das Alphabet. Beim Abtasten einer gedruckten Seite erkannte dieser den Buchstaben O. Die Druckerpresse hatte diesen Buchstaben stärker in das Papier gepresst. Das brachte Haüy auf die Idee, Buchstaben in Papier zu prägen, die dann mit den Fingern gelesen werden konnten.
Die Lettern vom Buchdruck konnten nicht verwendet werden, da diese spiegelverkehrt waren und der Drucksatz von rechts nach links erfolgte. Er ließ Metallbuchstaben anfertigen und eine Matrize, das Negativstück, damit sich die Prägung nicht verformte. Es waren viele Versuche notwendig, die richtige Auswahl des Papiers zu finden. Um zu vermeiden, dass das Papier anklebte, behandelte er die Metalltypen mit Trockenseife. Als alle Parameter ineinander funktionierten, konnte Haüy eine größere Sammlung von wichtigen Büchern in Prägeschrift für den Unterricht bereitstellen.
Eine Besonderheit war auch die „Haüy noire“. Um Blinden und auch Sehenden das Gedruckte leicht lesbar zu machen, wurden die Prägebuchstaben geschwärzt, indem man mit Tinte bestrichenes Pergamentpapier auf die zu prägende Seite legte.
Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts entschied man sich, die in Papier gepresste Schwarzschrift als einheitliche Vorlagen für die Vermittlung von Texten für den Unterricht mit blinden Jugendlichen einzusetzen.
Das Haüy-Alphabet
Valentin Haüy - 1784, Paris - Alphabet vermutet
Abbildung: Das vermutete Haüy-Alphabet
Die Stachelschrift wurde 1809 von Johann Wilhelm Klein erfunden. Die lateinischen Buchstaben waren dargestellt durch viele feine Nadeln, die man spiegelverkehrt ins Papier stanzte.
Die Schrift hatte keine durchgehende Linie, sondern viele kleine Punkte. Um den Text lesen zu können, musste Buchstabe für Buchstabe abgetastet werden, was sehr lange dauerte.
Der einzige Vorteil dieses Systems war, dass die Schrift von Sehenden und von Menschen mit Blindheit gelesen werden konnte.
Abbildung: Die Stachelschrift von Johann Wilhelm Klein - 1807, Wien
Artilleriehauptmann Charles Barbier erfand 1815 eine Schrift, die aus zwei Reihen zu je sechs erhabenen Punkten bestand. Hintergrund seiner Idee war, dass die Truppen damit an der Front die Nachrichten auch bei Dunkelheit lesen konnten und ihren Standort nicht durch das Anzünden von Kerzen verrieten.
Die Schrift von Barbier orientierte sich an der Aussprache. Durch die 12 Punkte war sie nicht so leicht zu erfassen und auch die Kennzeichnung für Silben und Vokale war sehr schwierig. Daher setzte sich seine Schrift in der Armee nicht durch.
Im Jahre 1819 kontaktierte Barbier das Institut Royal des Jeunes Aveugles in Paris und stellte 1820 die 12 Punkt-Schrift vor. Der elfjährige Louis Braille erkannte sofort, dass dieses System besser geeignet war, um Wissen zu vermitteln und taktil aufzunehmen. Er reduzierte die Komplexität der 12 Punkte auf sechs.
Die Schrift von Barbier war damit die Inspiration für Louis Braille, seine Blindenschrift zu entwickeln.
Abbildung: Nachtschrift-Alphabet nach Charles Barbier